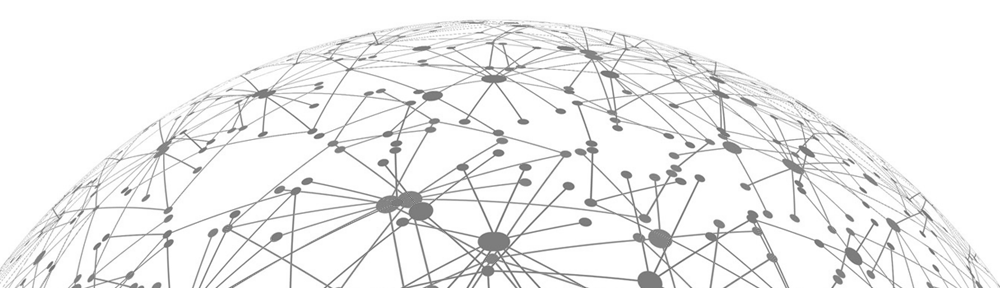Von Sybille Fuchs – 24. Juli 2025
Am 16. Juli starb im Alter von 88 Jahren der Theaterregisseur und Intendant Claus Peymann. Selten hat der Tod eines Theatermannes so viel Beachtung in Politik, Kulturwelt und in den Medien gefunden. Claus Peymann war einzigartig, und das nicht nur, weil er ein bedeutender Künstler war, der große deutschsprachige Theaterbühnen über viele Jahrzehnte geprägt hat. Am Anfang war er Rebell, am Schluss galt er als der letzte König des Theaters. Aber die Rolle des Rebellen behielt er bei.
Seine Bedeutung lag darin, dass er das Theater als politisch-gesellschaftlich bedeutsame und unverzichtbare Institution begriffen und verteidigt hat, ohne künstlerische Zugeständnisse zu machen. Genauso vehement hat er verteidigt, dass im Theater auch gelacht werden solle. Narren und Clowns gehörten für ihn genauso dazu wie tragische Helden und starke Frauen.
Geboren wurde er 1937 in Bremen, sein Vater war Lehrer und überzeugter Nationalsozialist, seine Mutter eine ebenso überzeugte Gegnerin Hitlers und der Nazis. Sie hörte in den letzten Kriegsjahren Feindsender und sehnte das Ende der Schlächterei herbei. Ihr Sohn Claus wuchs in den entscheidenden Konflikten des 20. Jahrhunderts auf, und seine Jugend war geprägt von der Stimmung des „Nie wieder“. Wie viele dieser Generation suchte er eine bessere Welt in Literatur, Kunst und Theater.
Stuttgart. Bochum. Wien. Berlin. Das waren die großen Spielstätten der Karriere von Peymann, aber seine Anfänge lagen beim Studententheater der 1960er Jahre, zuerst in Hamburg, wo er Germanistik, Literatur- und Theaterwissenschaft studierte. Er sagte später über seine Hamburger Anfänge: „Ich wollte Schriftsteller werden. Mindestens Journalist“, und fuhr fort: „Dass ich Regisseur wurde, war Zufall. Jemand fiel aus im Hamburger Studententheater, wo ich ab 1960 mitmachte, dann habe ich übernommen, und es wurde natürlich gleich ein Welterfolg.“
Das Studententheater hatte seine Blütezeit in den 1950er und frühen 1960er Jahren. In der Nachkriegszeit begann es damit, die Stücke aufzuführen, die während der Nazizeit verboten und deren Autoren Nazigegner waren, im Exil lebten oder unerwünschte Ausländer waren. Darunter befanden sich auch die Stücke von Bertolt Brecht, um den die Stadttheater in Westdeutschland in der Zeit des Kalten Kriegs noch lange Zeit einen Bogen machten.