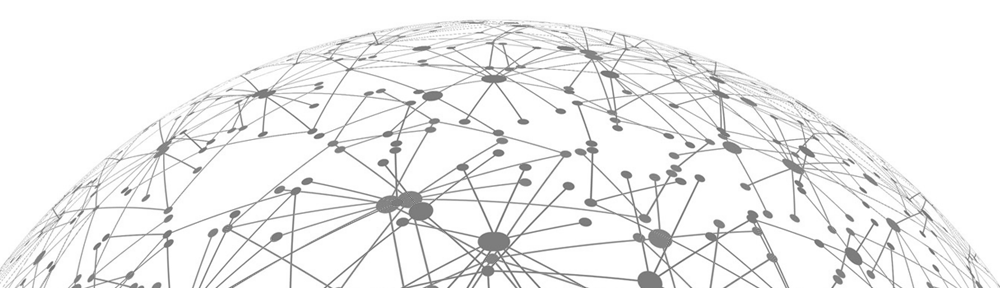Von Detlef Koch – 23. Oktober 2025
Während in Israel selbst hunderte kritische Stimmen gegen die Regierung Netanjahu protestieren und während internationale Gerichte über mutmaßliche Kriegsverbrechen verhandeln, wächst in Deutschland ein innenpolitischer Konsens, der jede grundsätzliche Kritik an der israelischen Politik unter Antisemitismusverdacht stellt. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die seit 2017 in Bund, Ländern und Kommunen als faktische Grundlage staatlicher Antisemitismuspolitik gilt.
Teil I: Das neue Dogma
Seit dem 7. Oktober 2023 hat sich die politische Landschaft dramatisch verändert. Der Angriff der Hamas auf Israel und die darauffolgenden, bis heute andauernden Vergeltungsaktionen in Gaza markieren nicht nur eine neue Eskalationsstufe im zionistisch motivierten und religiös verbrämten Besatzungsterror– sie haben auch in Deutschland eine bemerkenswerte Verengung des Diskursraums zur Folge.
Zur Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): Was ursprünglich als Schutzinstrument gegen Judenhass gedacht war, ist inzwischen zu einem normierenden Werkzeug der politischen Disziplinierung geworden – mit weitreichenden Folgen für jüdische Identitätsdebatten und die Meinungsfreiheit in Deutschland. Denn die IHRA-Definition verknüpft Antisemitismus explizit mit der „Wahrnehmung von Israel als jüdisches Kollektiv“ und macht damit Kritik an Israels Politik angreifbar. Diese semantische Verschiebung hat es ermöglicht, dass nicht nur palästinensische, muslimische oder linke Gruppen ins Visier geraten, sondern vermehrt auch jüdische Menschen selbst – sofern sie sich antizionistisch positionieren oder der israelischen Staatsräson skeptisch gegenüberstehen. Wer sich in Deutschland als Jude oder Jüdin gegen die Gleichsetzung von Zionismus und Judentum wendet, läuft Gefahr, als illoyal, selbsthassend oder sogar antisemitisch gebrandmarkt zu werden.