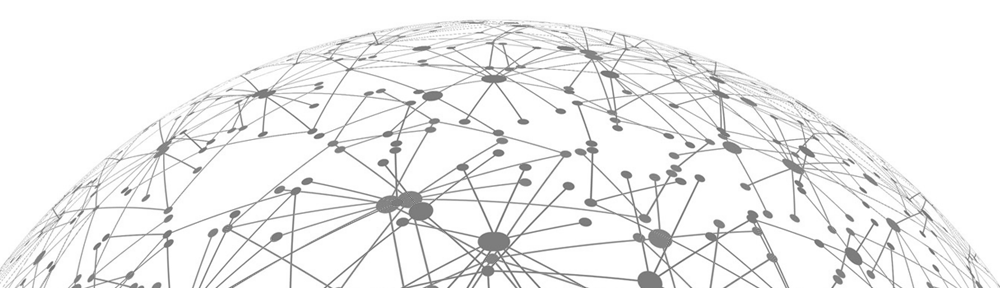Von Sabiene Jahn – 6. Oktober 2025
Das Feindbild Russland ist in den vergangenen Jahren zur großen Schablone europäischer Sicherheitspolitik geworden. Es dient als Folie, auf die nahezu jedes sicherheitspolitische Dossier projiziert werden kann: Abschreckung, Sondervermögen, Truppenübungen, Sanktionen, neue Rüstungsprogramme, die Einführung oder Reaktivierung wehrpflichtiger Strukturen und die Normalisierung militärischer Präsenz in zuvor zivilen Bereichen des Alltags. Der Kern dieser Schablone ist ein Versprechen und eine Behauptung: Das Versprechen lautet, mit Aufrüstung Sicherheit herzustellen. Die Behauptung lautet, Russland plane den Angriff auf Europa. Ohne diese zweite Behauptung fiele die politische Rechtfertigung der ersten in sich zusammen.
Dass dieser Zusammenhang kein Zufall ist, sondern einer langen historischen Kontinuität und einer gegenwärtigen politischen Logik folgt, lässt sich zeigen, wenn man Feindbilder als Instrumente versteht. Sie gehen Kriegen voraus, begleiten sie und halten sie im Bewusstsein stabil. „Feindbilder legitimieren Aufrüstung, Konfrontation und letztlich Krieg“, sagt der österreichische Historiker und Ökonom Hannes Hofbauer in einem Gespräch mit Journalist Peter Wahl. Genau dieser Legitimationsmechanismus prägt den europäischen Diskurs seit Jahren.
Wer Feindbilder analysiert, muss zunächst unterscheiden, wovon die Rede ist. Persönliche Wut und Trauer, wie sie Opfer realer Gewalt empfinden, sind nicht mit einem politisch konstruierten Feindbild zu verwechseln. Das Feindbild im engeren Sinn ist ein gesellschaftlich eingeübtes Muster, ein Set aus Zuschreibungen, das sich in Sprache, Bildern, Ritualen und politischen Routinen niederschlägt. Es ist kein spontanes Gefühl, sondern eine immer wieder abrufbare Denkfigur. Diese Figur besitzt einen historischen Resonanzraum. Die ersten westlichen Klischees über „die Russen“ lassen sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen, als an der Jagiellonen-Universität Krakau (Polen) ein Bild des Russen als „barbarisch, schmutzig, ungläubig“ geprägt wurde. Solche Schablonenbilder verbanden religiöse Abwertung mit kultureller Herabsetzung und wurden seither in Krisenzeiten jeweils neu aktiviert. Die Feindschaft war nicht konstant, sie flachte ab und kehrte wieder, wenn geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Spannungen dies opportun erscheinen ließen. Genau diese Reaktivierbarkeit macht das Feindbild zu einem politischen Werkzeug.